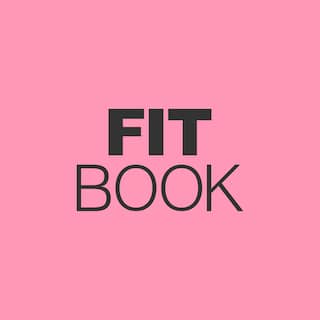
21. Februar 2025, 17:09 Uhr | Lesezeit: 4 Minuten
Einfach laufen lassen – für viele Männer ist das am Pissoir nicht so leicht, sobald sie nicht allein sind. Obwohl die Blase drückt, passiert nichts. Der Grund liegt im Kopf: Eine mentale Blockade verhindert die Entspannung des Blasenmuskels. Doch was steckt dahinter, und gibt es Wege, diese Hürde zu überwinden?
Beim Urinieren in öffentlichen Toiletten geraten manche Menschen unter Druck – mitunter so sehr, dass es schlicht nicht klappt. Besonders Männer sind von diesem Phänomen betroffen. In schweren Fällen spricht man von Paruresis, einer sozialen Angststörung, unter der Schätzungen zufolge eine Million Männer und eine halbe Million Frauen leiden.1
Jetzt dem FITBOOK-Kanal bei Whatsapp folgen!
Übersicht
Was versteht man unter Paruresis?
Der Begriff Paruresis bezeichnet die Schwierigkeit oder Unfähigkeit, an öffentlichen Toiletten oder in der Nähe anderer Menschen zu urinieren – selbst bei starkem Harndrang. Das Syndrom, auch als „schüchterne Blase“ oder „psychogener Harnverhalt“ bekannt, zählt zu den sozialen Angststörungen.
Die Betroffenen empfinden das Urinieren in Gegenwart anderer als so unangenehm, dass sich der Blasenmuskel nicht entspannt. In schweren Fällen führt dies dazu, dass öffentliche Toiletten ganz gemieden werden. Besonders Männer sind betroffen, doch auch viele Frauen kennen das Problem.
Für Außenstehende mag das absurd wirken, doch psychologisch ist es nachvollziehbar: Paruresis entwickelt sich oft durch negative Erfahrungen und tief sitzende soziale Ängste. Manche Betroffene fürchten, dass andere sie hören oder bewerten könnten. In ihrem Weltbild gibt es – überspitzt gesagt – unter Männern einen unausgesprochenen Machtkampf, bei dem souveränes Urinieren ein Zeichen von Überlegenheit ist.2
Auch interessant: Aus diesem Grund stagniert die Lebenserwartung der Menschen in Europa
Warum tritt die Blockade auf?
„Zum Wasserlassen benötigen wir eine Entspannung des Blasenschließmuskels. Und die kriegt man nur hin, wenn man selbst auch einigermaßen entspannt ist“, erklärt der Psychotherapeut Enno Maaß. Doch genau das kann in öffentlichen Toiletten schwerfallen.
Das Pissoir ist ein Ort, an dem man sich in einer ungewohnten, intimen Lage befindet – das Geschlechtsorgan ist entblößt, andere stehen in unmittelbarer Nähe. „Wird man dann angespannt, geht häufig ein Gedankenkarussell los. Man fragt sich: ‚Jetzt stehe ich hier schon eine Weile und kann gar nicht pinkeln. Und der neben mir denkt jetzt vielleicht schon, warum der am Pissoir steht und gar nicht pinkelt?‘ Dadurch wird man noch angespannter und es wird noch schwieriger, den Blasenmuskel zu lockern.“
Dieses Versagensgefühl ähnelt anderen psychologischen Blockaden, wie sie etwa in Prüfungssituationen auftreten. „Man kann das als kleine mentale Blockade betrachten. Mentale Blockaden im eigentlichen Sinne entstehen oft in ausgereiften Drucksituationen. Etwa, wenn man in einer Prüfung Gedanken ans Versagen bekommt und darum blockiert: Man steht in einer Bewertungssituation und funktioniert nicht mehr – die Situation am Pissoir weist da durchaus Parallelen auf“, so Maaß.
Wie kann man Paruresis überwinden?
Mentale Tricks zur Entspannung
Es gibt verschiedene Methoden, um die Blockade zu lösen. Ein einfacher Ansatz ist es, sich von der Situation gedanklich zu distanzieren. „Schafft man es, sich gedanklich aus der Situation herauszunehmen, kann das beim Lockerlassen helfen. Indem ich mich auf das Muster der Fliesen an der Wand vor mir fokussiere, zum Beispiel. Oder ich mache die Augen zu und atme tief ein und aus“, empfiehlt Maaß.
Ein weiterer Trick besteht darin, sich eine Routine oder ein Mantra anzueignen. Wer zu Hause beim Urinieren bewusst einen positiven Satz wiederholt, kann diesen auch in Stresssituationen nutzen. Bei leichter Paruresis hilft oft schon der Gedanke an fließendes Wasser.
Psychotherapie als langfristige Lösung
In schwereren Fällen reicht das jedoch nicht aus. Dann kann eine kognitive Verhaltenstherapie helfen, die Ängste systematisch abzubauen. „Wenn sich das Ganze zu einer ausgewachsenen Angststörung ausweitet und zu massivem Leiden führt, spricht man von einer sogenannten Paruresis. Hier kann eine Psychotherapie helfen“, sagt Maaß.
Viele Betroffene scheuen sich, über das Problem zu sprechen – oft, weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie unter einer anerkannten Angststörung leiden. Der erste Schritt zur Besserung ist daher das Eingeständnis, dass man Hilfe benötigt.

Was hinter dem Phänomen „schüchterne Blase“ steckt

Gym Anxiety – wenn das Fitnessstudio Angst macht

Angst vor Spritzen sollte im Extremfall behandelt werden
Ist Paruresis gefährlich?
Körperlich ist die schüchterne Blase in den meisten Fällen unbedenklich. Auch wenn das Wasserlassen über längere Zeit nicht gelingt, sind medizinische Folgen selten. Problematisch wird es, wenn sich das Vermeidungsverhalten im Alltag stark einschränkt – etwa, wenn lange Reisen oder der Arbeitsplatz zur Herausforderung werden.
Auch wenn Paruresis keine körperlichen Schäden verursacht, kann die psychische Belastung erheblich sein. Deshalb lohnt es sich, das Problem anzugehen – sei es mit kleinen mentalen Tricks oder professioneller Unterstützung. Denn am Ende steht nicht nur eine Erleichterung beim Urinieren, sondern eine spürbare Steigerung der Lebensqualität.
*mit Material von dpa

