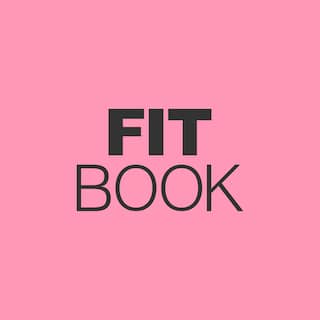
28. Februar 2025, 3:53 Uhr | Lesezeit: 7 Minuten
Jede Nacht taucht das Gehirn in eine Welt aus Bildern, Emotionen und Fantasien ein – doch am Morgen bleibt oft nur ein vages Gefühl zurück. Wer sich seine Träume bewusst merken möchte, kann das trainieren. Wie das genau funktioniert, erklären Experten.
Dass das Gehirn rund um die Uhr und auch im Schlaf aktiv bleibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch was passiert eigentlich im Gehirn, während wir träumen? Je nach Schlafphase können unterschiedliche Arten von Träumen entstehen. Mehr dazu und wie Sie sich an Geträumtes besser erinnern können, erfahren Sie im Folgenden.
Jetzt dem FITBOOK-Kanal bei Whatsapp folgen!
Übersicht
Was passiert beim Träumen im Gehirn?
Unter dem Begriff „träumen“ kann man sich eine Abfolge von Bildern, Emotionen und Gefühlen vorstellen, die in der sogenannten REM-Phase des Schlafs auftreten. Der Begriff REM stammt aus dem Englischen (Rapid Eye Movement) und bedeutet übersetzt „schnelle Augenbewegungen“. Das menschliche Gehirn bleibt in dieser Schlafphase besonders aktiv – teilweise sogar aktiver als im wachen Zustand.
Interessant dabei: Während des REM-Schlafs werden neuronale Verbindungen gestärkt, die unter anderem das Gedächtnis fördern. Zudem werden Hormone wie Dopamin und Serotonin neu gebildet, die für Lernprozesse und das Erinnerungsvermögen wichtig sind. So kann der REM-Schlaf dazu führen, dass man tagsüber aufmerksamer, konzentrierter und ausgeglichener ist.
Zusätzlich sorgt die Produktion von Hormonen dafür, dass die Muskulatur des Menschen vorübergehend erschlafft. In diesem Fall spricht man von einer REM-Atonie. Die Erschlaffung der Muskulatur verhindert, dass Träume körperlich ausgelebt werden können. Im Durchschnitt verbringt man pro Nacht ungefähr zwei Stunden mit Träumen. Diese Trauminhalte können Rückschlüsse auf den Alltag zulassen. Einige Kulturen betrachten Träume als göttliche Warnungen, Botschaften oder spirituelle Erkundungen der Seele. In diesem Zusammenhang gelten sie manchmal auch als Möglichkeit, böse Geister vorherzusagen oder sogar mit Verstorbenen in Kontakt zu treten.1
Warum träumt der Mensch jede Nacht?
Die genaue Antwort auf diese Frage ist bislang nicht geklärt. Es gibt jedoch unterschiedliche Theorien, die davon ausgehen, dass Träume dabei helfen können, neue Erfahrungen ins Gedächtnis zu integrieren oder emotionale Erlebnisse zu verarbeiten. Andere Erklärungsansätze gehen davon aus, dass Träume eine Reaktion auf äußere Reize sind, die während des Schlafs wahrgenommen werden.
„Im Prinzip träumen alle Menschen beim Schlafen, andernfalls ist etwas mit dem Gehirn nicht in Ordnung“, erklärt Prof. Michael Schredl, wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim.2 Manche Träume sind realitätsnah und beruhen auf Erinnerungen, andere wiederum sind völlig neue, kreative Szenarien.
Unterschiedliche Schlafphasen, unterschiedliche Träume
Und auch die Art des Traumerlebens ist im Laufe der Nacht ganz unterschiedlich. „Das liegt an den unterschiedlichen Zyklen, die der Körper während des Schlafens durchläuft“, erläutert Dr. Alfred Wiater, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM).3
Nach dem Einschlafen folgt zunächst eine Phase des Leichtschlafs, gefolgt vom Tiefschlaf, in dem der Körper besonders entspannt ist und das Gehirn nur wenig arbeitet. „Die Träume in diesen Schlafphasen sind kurz und abstrakt“, erklärt Wiater.
Intensiver wird es im sogenannten REM-Schlaf, der durch schnelle Augenbewegungen gekennzeichnet ist. „Im REM-Schlaf sind die Träume am intensivsten“, so der Experte. In dieser Phase entstehen besonders bildhafte und emotionale Trauminhalte.
Auch interessant: Welche Faktoren bestimmen, ob wir uns an Träume erinnern
Träume als Spiegel des Alltags
Doch was genau träumt man? Meistens geht es um Ereignisse, die tagsüber beschäftigt haben. „In der Regel geht es um das, was einen tagsüber beschäftigt“, sagt Schredl. Dazu können freudige Erlebnisse wie eine geplante Reise ebenso gehören wie Stress oder Auseinandersetzungen im Beruf.
Manchmal sind Träume jedoch völlig losgelöst von der Realität. „Das zeigt, wie kreativ das Gehirn manchmal ist“, betont Schredl. Gerade durch die Auseinandersetzung mit Träumen kann man mehr über sich selbst erfahren – auch dann, wenn es sich um belastende oder beängstigende Inhalte handelt.
Was sind Albträume?
Albträume haben viele Facetten: Man erlebt einen Fall in die Tiefe, den Verlust eines geliebten Menschen oder die Flucht vor etwas Bedrohlichem. Diese schlechten Träume, oft als „Nachtmahr“ bekannt, treten vor allem in der REM-Schlafphase auf.
In den meisten Fällen sind sie jedoch harmlos und führen lediglich zu unruhigem Schlaf. Treten sie jedoch über längere Zeit hinweg wiederholt auf und werden von den Betroffenen als besonders belastend empfunden, können gesundheitliche Probleme die Folge sein.
Auch die Frage, weshalb man Albträume hat, konnte bislang nicht geklärt werden. Es gibt allerdings einige Faktoren, die die Entstehung von Albträumen begünstigen könnten:
- Demenz
- Schwangerschaft: Hormonelle Veränderungen, können mit intensiven Emotionen einhergehen.
- Medikamente: wie Antidepressiva, Schlafmittel oder Blutdrucksenker können ebenfalls die Häufigkeit von Albträumen erhöhen
- Genetische Faktoren
- Stress
- Psychische Erkrankungen und Traumata: wie Angststörungen, Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) haben Einfluss auf das Schlafverhalten.
- Weitere Risikofaktoren: Schlafstörungen, Schlafmangel oder ein unregelmäßiger Schlafrhythmus. Zudem kann übermäßiger Drogenkonsum oder Alkoholkonsum können die Entstehung von Albträumen begünstigen.4
Alpträume bewusst verändern
Wie bereits erwähnt, können wiederkehrende Alpträume eine ernstzunehmende Belastung sein. „Ihnen liegt eine psychische Störung zugrunde, die aber sehr gut behandelbar ist“, erläutert Dr. Annika Gieselmann von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.5
Laut Experten können sich besonders hartnäckige Albträume im Gedächtnis als festes Skript verankern und so ihre ursprüngliche Funktion zur Verarbeitung von Erlebnissen verlieren. „Oft hilft es, sich entweder alleine oder mit einem Vertrauten zu überlegen, wie die Geschichte des Albtraums so verändert werden kann, dass sie nicht mehr schlimm ist“, rät Gieselmann.
Sollten diese Methoden nicht helfen, kann professionelle Unterstützung sinnvoll sein. „Ursache könnte dann gegebenenfalls eine psychische Belastungsstörung sein“, sagt Wiater.
Was machen Alpträume mit dem Körper?
Gerade während des Schlafs und im Traum verarbeitet das menschliche Gehirn Erlebnisse des Tages. So ist das limbische System, das für Gedächtnis, Lernprozesse und Emotionen zuständig ist, besonders aktiv. Dabei filtert das Gehirn unwichtige Informationen aus und verarbeitet alle relevanten Ereignisse – zu denen auch belastende Aspekte zählen.
Erlebt man einen Albtraum, steigen die Muskelspannung und die Herzfrequenz enorm an. Auch die Atmung beschleunigt sich, und es kommt zu übermäßigem Schwitzen. Emotionen wie Trauer, Wut oder Angst nehmen im Verlauf des Traums zu.

Studien belegen Die Menschen haben seit Corona öfter Albträume

Psychologie Welche Faktoren bestimmen, ob wir uns an Träume erinnern

Abseits vom Träumen Was denkt das Gehirn, während wir schlafen? Studie hat’s untersucht
Die Erinnerung an Träume trainieren
Nicht jeder kann sich an seine Träume erinnern – doch das kann geübt werden. Laut Schredl hilft es, sich vor dem Einschlafen bewusst vorzunehmen, sich an den Traum erinnern zu wollen. Auch praktische Hilfsmittel können dabei unterstützen: Ein Notizbuch oder ein Diktiergerät direkt neben dem Bett erleichtert es, Träume direkt nach dem Aufwachen festzuhalten.
Eine weitere Technik: Während des Erwachens sollte man sich das Geträumte immer wieder vorsagen, ähnlich wie beim Auswendiglernen eines Gedichts. So bleibt das nächtliche Kopfkino besser im Gedächtnis – und offenbart spannende Einblicke in die eigene Gedankenwelt.



