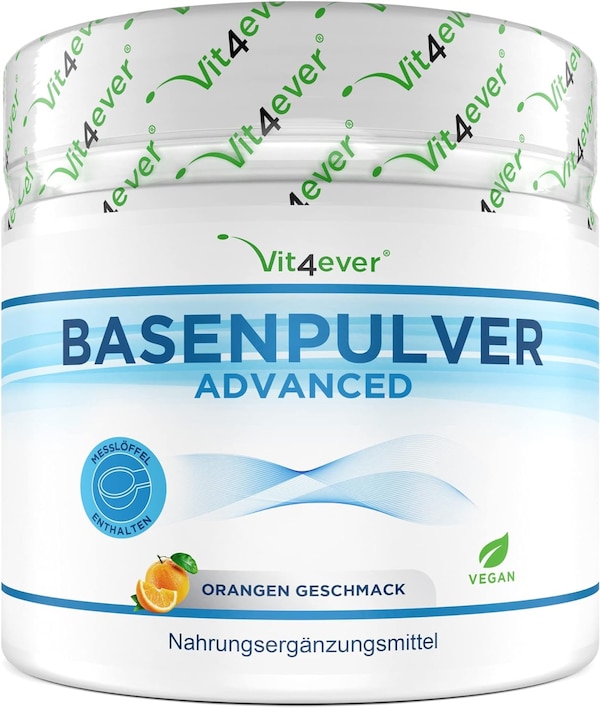11. Februar 2025, 11:30 Uhr | Lesezeit: 9 Minuten
Gemäß der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten e.V. (DGSV) gibt es mittlerweile mehr als 600.000 Menschen in Deutschland, die von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung (CED) betroffen sind (Stand 2024). Chronisch entzündliche Darmerkrankungen gehen unter anderem mit blutig-schleimigen Durchfällen, Bauch- und Gelenkschmerzen sowie Fieber einher. Inwieweit Sport positive Auswirkungen auf den Verlauf von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa hat, erklärt FITBOOK-Expertin Alina Bock.
Betroffene von CED leiden oftmals unter Abgeschlagenheit, vermindertem Wohlbefinden und mitunter auch unter Depressionen. Diese Faktoren beeinflussen wiederum den Krankheitsverlauf von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen negativ.1 Besonders hierbei kann Sport helfen, die genannten Faktoren und demnach den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Fitnessexpertin Alina Bock erläutert anhand der aktuellen Studienlage die positiven Effekte von Sport beim Verlauf von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
Jetzt dem FITBOOK-Kanal bei Whatsapp folgen!
Übersicht
- Arten, Symptome und Diagnose von CED
- CED führt zu Muskelmasse-, Fett- und Knochenverlust
- Die Wirkung von Kortison auf die Knochen
- Sport kann helfen, die Knochendichte von CED-Betroffenen zu verbessern
- Sport kann das Mikrobiom des Darms positiv beeinflussen
- Auswirkungen von Sport auf die Lebensqualität von CED-Patienten
- Studie zeigt geringere Wahrscheinlichkeit eines erneuten Schubs bei aktiven Patienten
- Fazit
- Quellen
Arten, Symptome und Diagnose von CED
Zu den häufigsten chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehören Morbus Crohn sowie Colitis ulcerosa. In der Symptomatik ähneln sich die beiden Erkrankungen, unterscheiden sich jedoch im Bereich der Entzündung. Morbus Crohn kann jeden Teil des Verdauungstrakts betreffen, während Colitis ulcerosa ausschließlich im Dickdarm auftritt.
Typische Symptome einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung sind:
- Durchfälle (häufig blutig und/oder schleimig)
- Krampfartige Bauchschmerzen
- Übelkeit
- Gewichtsverlust
- Fieber
Darüber hinaus kann es zu Beschwerden außerhalb des Magen-Darm-Trakts kommen. Diese können sein:
- Gelenkschmerzen und -entzündungen
- Entzündungen an den Augen
- Veränderungen der Haut
- Leberentzündungen
- Nieren- und Gallensteine
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen treten in Schüben auf. Hierbei wechseln sich Phasen mit hoher Krankheitsaktivität mit beschwerdefreien Phasen, auch Remission genannt, ab. Wie häufig und intensiv Schübe auftreten, unterscheidet sich von Patient zu Patient.
Diagnostiziert wird eine chronisch entzündliche Darmerkrankung mithilfe des Blutbildes und Stuhluntersuchungen. Um eine endgültige Diagnose stellen zu können, kommen bildgebende Verfahren wie die Magen- und/oder Darmspiegelung zum Einsatz. Hierbei kann es auch sein, dass Gewebeproben entnommen werden, welche anschließend untersucht werden.
CED führt zu Muskelmasse-, Fett- und Knochenverlust
Aufgrund einiger Symptome wie immer wiederkehrenden Durchfällen, Übelkeit sowie Appetitlosigkeit führen chronisch entzündliche Darmerkrankungen zu einem Verlust von Körpermasse. Betroffene von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen verlieren nicht nur Fett, sondern ebenfalls fettfreie Masse in Form von Muskulatur.2 Außerdem zeigen Betroffene von CED als Folge von einem Mineralstoff- und Vitaminmangel einen Verlust von Knochenmasse und Knochenmineraldichte.3
Eine Studie aus dem Jahr 2003, die im in der Fachzeitschrift „The American Journal of Gastroenterology“ veröffentlicht wurde, bestätigt diese Annahme. Die Studie zeigte, dass Betroffene einen deutlich niedrigen Mineralgehalt der Knochen sowie einen signifikant niedrigeren Anteil an fettfreier Masse aufwiesen als gesunde Personen. Betroffene von Colitis ulcerosa zeigten im Vergleich zu Patienten mit Morbus Crohn einen besseren Wert in Bezug auf Knochenmineralgehalt und fettfreier Masse.4
Auch interessant: Ursache, Symptome und Behandlung des Reizdarm-Syndroms
Die Wirkung von Kortison auf die Knochen
Doch nicht nur die Symptomatik einer CED führt zu einem Abbau der Knochenmasse. Auch bestimmte Medikamente, wie Kortison, welche zur Unterdrückung der Entzündungsaktivität verschrieben werden, stimulieren als Nebenwirkung den Knochenabbau und unterdrücken langfristig den Knochenaufbau.5
Nebenwirkungen von Kortison auf die Knochen:
- Kortison fördert den Knochenabbau; es hemmt die Osteoblasten (Knochenaufbauzellen) und fördert die Aktivität der Osteoklasten (Knochenabbauzellen)
- Kortison kann die Aufnahme von Kalzium im Darm verringern, was zu einem Kalziummangel und folgend zu einer negativen Beeinflussung der Knochengesundheit führen kann
- Kortison kann die Synthese von Kollagen hemmen, was sich auf die Stabilität und Festigkeit der Knochen negativ auswirkt
Auch interessant: Wie wirkt sich Kollagen auf die sportliche Leistungsfähigkeit aus?
Sport kann helfen, die Knochendichte von CED-Betroffenen zu verbessern
Positive Effekte von Sport auf die Knochendichte, insbesondere durch Krafttraining, sind bereits erwiesen.6 Somit lässt sich vermuten, dass Sport sich auch für Personen mit CED als erfolgreiche Maßnahme für die Stimulation des Knochenaufbaus erweisen kann und so einen vorherigen Verlust wieder ausgleichen kann.
Eine 2020 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Alimentary Pharmacology and Therapeutics“ veröffentlichte Studie untersuchte die Auswirkungen eines sechsmonatigen kombinierten Impact- und Widerstandstrainings auf die Knochendichte und die Muskelkraft von Erwachsenen mit CED. Hierfür wurden 47 Personen in eine Übungsgruppe sowie eine Kontrollgruppe eingeteilt. Die Erwachsenen aus der Übungsgruppe wurden dem Trainingsprogramm unterzogen und anschließend mit der Kontrollgruppe verglichen. Die Ergebnisse zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe einen Zuwachs an Knochendichte, vor allem im Bereich der Lendenwirbelsäule. Zudem zeigte die Übungsgruppe eine höhere Muskelkraft sowie eine niedrigere Ermüdungsintensität im Vergleich zur Kontrollgruppe.7
Insbesondere Krafttraining kann demnach dazu beitragen, die Knochenmineraldichte positiv zu beeinflussen. Da besonders Menschen mit CED von einem Verlust an Knochenmasse und -dichte betroffen sind, sollte in der Phase der Remission Krafttraining herangezogen werden, um diese wieder zu verbessern.
Wichtig: Sport ist während einer Phase mit hoher Krankheitsaktivität nicht förderlich. Während eines Schubs sollte auf Sport mit höherer Intensität verzichtet werden. Auch während der Gabe von Kortison ist intensives Krafttraining nicht ratsam. Die Empfehlungen hinsichtlich sportlicher Aktivität beziehen sich somit vor allem auf die Phase der Remission. Wer dennoch während eines Schubs körperlich aktiv sein möchte und sich danach fühlt, kann auf Sport mit niedrigeren Intensitäten wie gemäßigtes Fahrradfahren, Yoga, Spazieren oder Ähnliches zurückgreifen.
Sport kann das Mikrobiom des Darms positiv beeinflussen
Der Darm des Menschen beherbergt nahezu eine Billion Mikroben. Dazu zählen Bakterien, Pilze, Viren und andere Mikroorganismen. Die Vielfalt des Mikrobioms hat die Aufgabe, die Verdauung zu unterstützen. Außerdem spielt sie eine große Rolle für die Funktionsfähigkeit unseres Immunsystems. Ein gesundes Mikrobiom zeichnet sich durch eine hohe Biodiversität aus. Bei Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung konnte festgestellt werden, dass das Mikrobiom im Darm in seiner Menge und Diversität stark eingeschränkt ist. Dies führt zu Entzündungen und Problemen im Darm.
Mehrere Studien verweisen darauf, dass körperliche Belastung die Zusammensetzung der menschlichen Darmmikrobiotika positiv beeinflusst.8 Untersuchungen zeigten, dass körperliche Aktivität die Variabilität sowie Prävalenz des Bakteriums Phylum Firmicutes, insbesondere bei Athleten, steigere. Diese Gruppe von Bakterien ist maßgeblich an der Verdauung von Lebensmitteln, der Fermentation von Ballaststoffen sowie bei der Produktion von kurzkettigen Fettsäuren beteiligt, die zur Gesundheit des Darms beitragen. Sie sind an metabolischen, schützenden, strukturellen sowie histologischen Funktionen des Darms beteiligt. Um die Auswirkungen von Sport auf das Mikrobiom noch genauer zu beleuchten, müssen weitere Studien durchgeführt werden. Die vorhandenen Studien zeigen jedoch, dass es Hinweise auf positive Effekte von physischer Belastung auf die Darmflora gibt.
Auswirkungen von Sport auf die Lebensqualität von CED-Patienten
Auch die Auswirkungen von Sport auf das Wohlbefinden und die Gesundheit von CED-Patienten wurde bereits in mehreren Forschungsarbeiten betrachtet.
Eine Studie aus dem Jahr 2015 untersuchte die Auswirkungen eines zehnwöchigen Trainingsprogramms auf das Wohlbefinden von CED-Patienten sowie die Entzündungsaktivität. 30 Personen wurden eine eine Untersuchungsgruppe, die regelmäßig mäßig intensive Laufeinheiten absolvierte und in eine Kontrollgruppe ohne Sportprogramm eingeteilt. Die Untersuchung zeigt, dass die CED-Betroffenen nicht nur in der Lage waren, regelmäßiges Lauftraining zu absolvieren, sondern auch, dass sich das Wohlbefinden der Patienten der Laufgruppe deutlich verbesserte.9
Eine weitere Studie aus dem Jahr 2021 untersuchte ebenfalls die Korrelation zwischen körperlicher Aktivität und Lebensqualität bei koreanischen Patienten mit CED. In der Studie wurden insgesamt 158 Patienten zu ihrer körperlichen Aktivität und Lebensqualität befragt. Anschließend wurden sie nach Aktivitätsniveau in drei Gruppen (am wenigsten aktiv, mäßig aktiv sowie am aktivsten) aufgeteilt. Die Ergebnisse zeigten, dass höhere Aktivitätsniveaus mit einer deutlich verbesserten Lebensqualität einhergingen als niedrigere Aktivitätsniveaus.10
Inwieweit sich Sport positiv auf das Wohlbefinden von Kindern mit CED auswirkt, untersuchte eine Studie aus dem Jahr 2023.11 Hierfür wurde ein zwölfwöchiges Lebensstilprogramm, inklusive drei sportliche Einheiten pro Woche und personalisiertem Ernährungsprogramm, an 15 Kindern mit CED getestet. Die Ergebnisse wurden anhand der körperlichen Fitness (maximale und submaximale Leistungsfähigkeit, Kraft und Rumpfstabilität), Patientenberichten (Lebensqualität, Müdigkeit und Ängste), klinischer Krankheitsaktivität sowie Ernährungszustand (Energiebilanz und Körperzusammensetzung) gemessen. Die Ergebnisse zeigten deutliche Verbesserungen hinsichtlich körperlicher Leistungsfähigkeit und Rumpfstabilität. Außerdem zeigten sich deutliche Verbesserungen in den Bereichen Entzündungsaktivität, Lebensqualität und Müdigkeit.
Studie zeigt geringere Wahrscheinlichkeit eines erneuten Schubs bei aktiven Patienten
Ergebnisse aus einer im Jahr 2015 in der Fachzeitschrift „Inflammatory Bowel Diseases“ veröffentlichten Studie lassen erahnen, dass es zudem einen Zusammenhang von sportlicher Aktivität und verringerter erneuter Entzündungsaktivität bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gibt.12
In der Studie wurde das Aktivitätsniveau sowie die Entzündungsaktivität von 1308 Patienten mit Morbus Crohn sowie 549 Patienten mit ulzerativer oder indeterminierter Kolitis, die sich am Anfang der Studie in Remission befanden, ermittelt. Ziel war, zu untersuchen, wie viele eine erneute Entzündungsaktivität entwickelten. Hierbei wurde insbesondere auf das Aktivitätsniveau der Patienten geachtet. Das Ergebnis: 17,4 Prozent der Betroffenen von Morbus Crohn sowie 24,6 Prozent der Betroffenen von ulzerativer oder indeterminierter Kolitis entwickelten eine erneute Erkrankung innerhalb der nächsten sechs Monate. Die Untersuchung zeigte, dass bei Patienten mit hohem Bewegungsniveau eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit bestand, nach sechs Monaten einen erneuten Schub zu entwickeln.
Es lässt sich also vermuten, dass ein hohes Bewegungsniveau den Krankheitsverlauf hinsichtlich erneuter Entzündungsaktivität bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung positiv beeinflusst. Es fehlen jedoch noch weitere aussagekräftige Studien zu dieser Thematik, die den Verdacht einer verringerten Entzündungsaktivität durch Sport erhärten.

Ursachen, Risikofaktoren Anzeichen und Behandlung der chronischen Darmerkrankung Colitis ulcerosa

Chronisch-entzündliche Darmerkrankung Vitamin D kann helfen, Colitis-ulcerosa-Symptome zu lindern

Darmerkrankung Symptome, die auf Morbus Crohn hindeuten
Fazit
In Deutschland gibt es schätzungsweise 600.000 Betroffene von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (DGSV). Vorherige Schätzungen gingen von ungefähr 400.000 Betroffenen aus. Somit ist die Anzahl an Erkrankten in den letzten Jahren um ein Drittel angestiegen. Vor allem aufgrund des rapiden Anstiegs an Diagnosen müssen weitere Studien hinsichtlich Behandlung und Lebensstil durchgeführt werden, um Betroffenen hilfreiche Empfehlungen geben zu können.
Bisherige Erkenntnisse aus Studien und anderen wissenschaftlichen Quellen verweisen darauf, dass Sport positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden von CED-Patienten sowie auf den Krankheitsverlauf und die Entzündungsaktivität haben kann. Außerdem kann Sport negativen Folgen von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Knochen- und Muskelverlust und einem gestörten Mikrobiom vorbeugen bzw. wiederherstellen. Sport ist somit allen CED-Betroffenen anzuraten, die sich in Remission befinden.