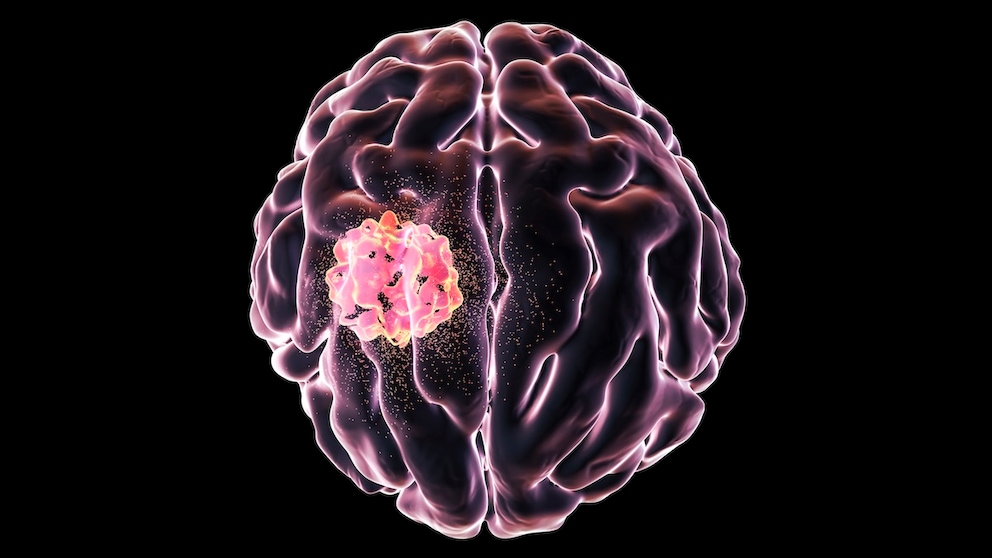13. Dezember 2024, 15:24 Uhr | Lesezeit: 5 Minuten
Ein Glioblastom ist einer der häufigsten bösartigen Hirntumore bei Erwachsenen – mit einer sehr geringen Aussicht auf Heilung. Aus diesem Grund fokussieren sich die Therapien und Behandlungen hauptsächlich auf die Maximierung der Überlebenszeit. Eine neue Studie liefert nun einen bisher unbekannten Hinweis darauf, wie man das Wachstum des Glioblastoms ausbremsen kann.
Ein Glioblastom entwickelt sich aus den Gliazellen (Stützgewebe) des Gehirns. Aber was begünstigt diese Erkrankung? Der einzige bisher bestätigte Risikofaktor ist eine vorangegangene Bestrahlung des Kopfes.1 Darüber hinaus stehen frühere Kopfverletzungen, Toxine und die Ernährung im Zusammenhang mit der Entstehung des bösartigen Hirntumors. Die Standardtherapie baut auf der Kombination aus Operationen, Bestrahlungen und Chemotherapien auf. Eine Studie stieß nun auf einen neuen Therapie-Ansatz, der das Wachstum eines Glioblastoms verlangsamen könnte.
Jetzt dem FITBOOK-Kanal bei Whatsapp folgen!
Übersicht
Glioblastom hält sich an den zirkadianen Rhythmus
Forscher der Washington University in St. Louis gingen bei ihren Untersuchungen auf den zirkadianen Rhythmus ein, den man umgangssprachlich in dieser Studie auch als innere Uhr bezeichnet. Er besitzt die Fähigkeit, wichtige Prozesse im Körper auf eine Länge von einem Tag zu synchronisieren. Bedeutet: Er ist ein natürlicher Taktgeber beim Wechsel der Tageszeiten von hell auf dunkel. In diesem Rahmen reguliert er wichtige Vorgänge, wie bspw. Schlaf- und Aufwachzeiten, Essenszeiten usw.
Der Grund, warum sich die Wissenschaftler auf den Zusammenhang der inneren Uhr und dem Wachstum des Glioblastoms fokussierten, ist naheliegend. Denn der zirkadiane Rhythmus basiert auf den Signalen des Gehirns, welche die Abläufe koordinieren. „Unsere bisherigen Untersuchungen haben uns geholfen, ein Muster zu erkennen“, erklärt Dr. Maria Gonzalez-Aponte, Erstautorin der Studie, in einer Pressemitteilung. „Ob wir nun
klinische Daten von Patienten, gewonnene Zellen oder Mäuse mit Glioblastom-Modelltumoren untersuchten – die Chemotherapie wirkte immer um die normale Wachzeit herum am besten. Das brachte uns auf die Idee, dass diese Tumoren die Tageszeit erkennen.“ Ihre Nachforschungen zeigten, dass das Glioblastom ebenfalls nach dem zirkadianen Rhythmus funktioniert und diesen sogar ausnutzt.2
Auch interessant: „Seit mein Vater an einem Hirntumor erkrankte, lebe ich zuckerfrei“
Störung des Tagesrhythmus
Kurz bevor man aufwacht, sendet das Gehirn ein Signal an die Nebenniere – eine Reaktion auf Licht und andere Umweltreize. Das sorgt dafür, dass Steroidhormone, die sogenannten Glukokortikoiden, ausgeschüttet werden. Ihre Aufgabe ist es, wichtige Prozesse im Stoffwechsel und in der Immunität zu regulieren. Zudem sind sie an der Kampf-oder-Flucht-Reaktion beteiligt. Die Forscher vermuteten, dass das Glioblastom eben auf diesen Schub des Hormons reagiert und so seine eigene innere Uhr mit dem zirkadianen Rhythmus des Wirts synchronisiert.
Um diese These zu belegen, testeten die Wissenschaftler an Mäusen, ob man die innere Uhr des Glioblastoms stören und somit das Wachstum verringern kann. Mittels wissenschaftlicher Methoden bildete man Glioblastom-Modelltumore in den Gehirnen der Tiere nach. Anschließend hielt man sie in einem Käfig, in dem man die Hell- und Dunkelphasen regulieren konnte. Somit war es möglich, den Zeitpunkt des Lichteinschaltens zu ändern. „Mäuse laufen nachts mehr in ihren Rädern als tagsüber“, erklärt Dr. Maria Gonzalez-Aponte, Erstautorin der Studie in einer Pressemitteilung.3 Als die Mäuse wieder anfingen in ihren Laufrädern zu laufen, war das die Bestätigung, dass der Zwang zur neuen Synchronisation ihres Tagesrhythmus funktionierte.
Beobachtung der Krebszellen
Während sich die Mäuse an ihren neuen Zeitplan gewöhnten, prüften die Wissenschaftler stetig die Veränderungen der Krebszellen im Gehirn. Mithilfe einer neuartigen Methode bildeten sie die Expression der Uhrgene in den Krebszellen der Mäuse nach – und stellten fest: Zwei dieser Uhrgene veränderten sich parallel mit der Neusynchronisation des Zeitplans der Tiere. „Wir haben festgestellt, dass Bmal1 und Per2 das Gleiche tun wie die Maus im Laufrad. Das heißt, die Krebszellen synchronisieren ihren Tagesrhythmus neu, während die Maus ihre Bewegungsaktivität neu synchronisiert“, so Gonzalez-Aponte. Das stehe im Zusammenhang mit der Glukokortikoiden-Ausschüttung.
Bedeutung für die Behandlung mit Glukokortikoiden
Glukokortikoide sind nur eines der zirkadianen Signale, das nachweislich die Uhren in Zellen im ganzen Körper synchronisieren kann. Bisher setzt man sie auch in hohen Dosen bei der Behandlung von Krebs ein, auch bekannt als DEX. Patienten mit einem Glioblastom bekommen dies verabreicht, um Hirnödeme zu reduzieren. Jedoch stellten sich nicht bei allen Patienten tumorunterdrückende Wirkungen ein, manche Ärzte berichten von einer eher förderlichen Wirkung.
Die Forscher der vorliegenden Studie vermuten deshalb, dass die Tageszeit bei der Verabreichung eine Rolle spielt, weil dadurch der zirkadiane Rhythmus gestört wird. Aus diesem Grund versuchten sie mit zusätzlichen Experimenten herauszufinden, wann die Tumorgröße durch DEX bei den Mäusen ab- bzw. zunahm. Sie stellten fest, dass die Tumorgröße bei den Tieren signifikant zunahm, wenn man DEX morgens verabreichte, im Gegensatz zur abendlichen Anwendungen.

Laut Studie Diese Vorteile hat es, jeden Tag zur gleichen Tageszeit zu trainieren

Mäusestudie Intervallfasten kann womöglich vor Alzheimer schützen

Zirkadianer Rhythmus Wie sich die innere Uhr auf Kopfschmerzen auswirkt
Einordnung der Studie
„Glioblastome orientieren sich an Hormonen, die von derselben zentralen Uhr im Wirt ausgeschüttet werden, die auch den regelmäßigen Tagesrhythmus des Körpers steuert“, fasst Dr. Erik D. Herzog, Hauptautor der Studie, zusammen. „Die Blockierung des täglichen Anstiegs der Glukokortikoid-Signalgebung desynchronisiert die zirkadianen Rhythmen im Glioblastom mit denen des Wirts und verlangsamt das Fortschreiten der Krankheit bei tumortragenden Mäusen dramatisch.“ Dabei könne eben die Tageszeit der bislang umstrittenen Verabreichung von Glukokortikoiden maßgeblich sein, um den zirkadianen Rhythmus so zu stören, dass dadurch das Wachstum des Glioblastoms verlangsamt wird.
Die Wissenschaftler sind sich aber der Einschränkungen ihrer Studie bewusst. Da die Untersuchungen nur auf Experimenten an Mäusen basieren, ist nicht klar, ob die Ergebnisse auch bei Menschen zutreffen würden. Da es sich bei DEX aber um kein neuartiges Medikament handelt, ist es möglich, bei darauf aufbauenden Studien zu versuchen, DEX nicht am Morgen, sondern zu verschiedenen Tageszeiten zu verabreichen.
„Die Wechselwirkung zwischen Hirntumoren und dem zirkadianen System ist jetzt ein gezielter Mechanismus zur Optimierung der Behandlung“, erläurtert Herzog das Potenzial der Studienergebnisse. „Wir glauben, dass dieser umsetzbare und übertragbare Ansatz letztendlich die Patientenversorgung personalisieren wird, indem er bestimmt, wann Krebspatienten je nach ihren individuellen zirkadianen Rhythmen behandelt werden sollten.“