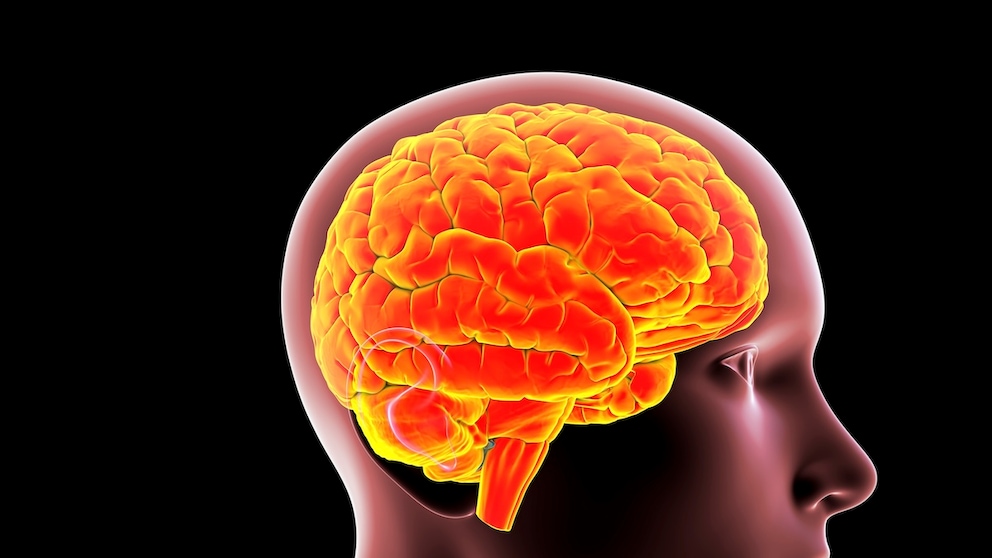31. März 2025, 10:57 Uhr | Lesezeit: 7 Minuten
Ein langer, komplizierter Name: Frühsommer-Meningoenzephalitis. Noch nie gehört? Aber FSME bestimmt! FSME ist eine gefürchtete Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, die durch Viren hervorgerufen wird. Vor allem beim Stichwort „Zecken“ ist uns FSME ein Begriff. Bei FITBOOK erfahren Sie alles über Ursachen, Symptome und wie Sie sich schützen können.
Ein Spaziergang in der Natur, ein bisschen garteln, ein Picknick im Grünen – und plötzlich ist er da, dieser komische schwarze Fleck: oh Schreck – eine Zecke! Unbemerkt hat sie sich unter die Haut gegraben. Da heißt es erst mal: keine Panik. Die meisten Zeckenstiche rufen nur milde Beschwerden hervor und heilen gut ab.1 Aber: Zecken können ernsthafte Krankheiten übertragen, wie FSME. Deswegen sollte man jeden Zeckenbiss genau beobachten.
Übersicht
Wie steckt man sich mit FSME an?
FSME steht für „Frühsommer-Meningoenzephalitis“. Das ist eine Virusinfektion. Vor allem kleine Nagetiere (wie Mäuse) tragen den Erreger in sich. Studien konnten aber auch Infektionen durch den Verzehr von Rohmilch von Ziegen, Schafen oder Kühen nachweisen.2 Der häufigste Übertragungsweg ist ein Zeckenstich. Die Viren sitzen in den Speicheldrüsen der Zecke und können durch den Stich rasch in unser Blut gelangen.3 Das Virus kann dann das Gehirn und die Hirnhäute (die Schutzhülle des Gehirns) befallen und schwere Entzündungen hervorrufen.4 Übrigens: Weil Zecken Blut saugen, ist es korrekter, von einem Zeckenstich und nicht von einem Zeckenbiss zu sprechen. Das Virus gelangt durch den Stich direkt in den Körper – anders als bei Lyme-Borreliose, die erst nach mehreren Stunden des Blutsaugens übertragen wird. Deshalb hilft schnelles Entfernen der Zecke nicht immer gegen eine Infektion. FSME kann nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden. Jemand, der FSME hat, ist also nicht ansteckend für andere.
Wo kommt FSME vor?
FSME tritt vor allem in Europa und Teilen Asiens auf. In Deutschland gehören Bayern, Baden-Württemberg, Südhessen, das südöstliche Thüringen, Sachsen und das südöstliche Brandenburg zu den besonders gefährdeten Regionen. Es gibt aber auch außerhalb dieser größeren Gebiete einzelne Landkreise, die „Zecken-Hotspots“ sind. Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht regelmäßig Karten, die die aktuellen FSME-Risikogebiete zeigen.
Seit 2001 erhebt das RKI die Anzahl der FSME-Erkrankungen. Im Jahr 2024 wurde mit 775 FSME-Erkrankungen die höchste Erkrankungszahl seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2001 gemeldet.5 Der Berufsverband deutscher Internistinnen und Internisten geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus und rechnet mit „langfristig steigenden Fallzahlen und häufigeren Zecken-Jahren mit früherer Zeckenaktivität.“6
Als Lebensraum bevorzugen Zecken feuchte, schattige Orte wie Wälder, Wiesen und hohes Gras. Sie sind vor allem zwischen April und Oktober aktiv, können aber in milden Wintern das ganze Jahr über vorkommen. Allerdings fallen sie nicht von Bäumen, wie man lange annahm, sondern sie sitzen lieber auf breiten Grasbüscheln oder niedrigem Blattwerk. Wenn wir daran vorbeigehen, „streichen“ wie sie sozusagen auf unsere Kleidung oder unsere Haut ab. Zwischen 0,5 und 5 Prozent aller Zecken in Risikogebieten tragen das FSME-Virus in sich.
Diese Symptome verursacht FSME
FSME entwickelt sich in der Regel in zwei Phasen. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Zeckenstich und ersten Symptomen, beträgt meist sieben bis 14 Tage. In Einzelfällen können es bis zu 28 Tage sein.7 Der typische Verlauf einer FSME-Erkrankung verläuft in zwei Phasen:
1. Phase
Zunächst fühlt man sich, als hätte man eine Grippe – mit Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und allgemeinem Unwohlsein. Viele denken zunächst an eine harmlose Erkältung. Bei etwa 40 Prozent der Fälle bleibt es bei dieser ersten Phase, besonders bei schweren Verläufen oder bei älteren Menschen (über 65 Jahre).
2. Phase
Nach einer symptomfreien Phase (etwa eine Woche) macht sich das Virus durch die Schäden bemerkbar, die es am Nervensystem anrichtet. Dann treten hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit und neurologische Beschwerden auf. In schweren Fällen kommt es zu Hirnhautentzündungen (Meningitis), Gehirnentzündungen (Enzephalitis) oder Rückenmarksentzündungen (Myelitis). Diese können bleibende Schäden wie anhaltende, bleierne Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Lähmungen oder Gedächtnisprobleme hinterlassen. In etwa ein Prozent der Fälle verläuft die Erkrankung sogar tödlich.8
Auch interessant: Symptome, die auf Lyme-Borreliose hindeuten
Wie erkennt und behandelt man FSME?
FSME kann durch eine Blutuntersuchung diagnostiziert werden: Im Blut befinden sich bei einer Infektion Antikörper, die im Labor identifiziert werden können. Antikörper können meist mit Beginn der zweiten Krankheitsphase nachgewiesen werden. In der frühen Phase kann ein PCR-Test sinnvoll sein. Das Erbgut des FSME-Virus kann mithilfe dieses Labortests im Blut oder in der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit nachgewiesen werden. Allerdings ist dieser Test nur in der ersten Krankheitsphase möglich, etwa sieben Tage nach dem Zeckenstich.9
Eine gezielte Behandlung gegen das Virus gibt es nicht. Die Therapie beschränkt sich auf das Lindern der Symptome. In schweren Fällen müssen Betroffene im Krankenhaus behandelt werden, manchmal sogar auf der Intensivstation.

Gefahr durch FSME-Erreger Tipps, wie man sich beim Outdoor-Sport vor Zecken schützen kann

Gefährliche Krankheitserreger 6 Tipps, wie man Kinder vor Zeckenbiss, Borreliose und FSME schützt

RKI nennt 3 neue Regionen Gefahr durch Zecken! Das sind die offiziellen FSME-Risikogebiete
So kann man sich vor FSME schützen
Impfung
Da FSME nicht gezielt behandelt werden kann, ist eine Impfung der beste Schutz. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt diese Impfung für alle, die sich regelmäßig in FSME-Risikogebieten aufhalten. Sie besteht aus drei Dosen und muss regelmäßig aufgefrischt werden. Es gibt zwei Impfstoffe, die für Kinder ab zwölf Monaten zugelassen sind.10 Die Impfschemata sind für die beiden Impfstoffe unterschiedlich – sie gelten für Kinder und Erwachsene.
| Impfstoff: „FSME-Immun“ | Standardimpfung | Schnellimpfung |
|---|---|---|
| 1. Impfdosis | Tag Null | Tag Null |
| 2. Impfdosis | 1-3 Monate später | 14 Tage später |
| 3. Impfdosis | 5-12 Monate später | 5-12 Monate später |
| 1. Auffrischimpfung | 3 Jahre später | 3 Jahre später |
| Auffrischimpfungen | Alle 5 Jahre (< 60 Jahre) | Alle 3 Jahre (≥ 60 Jahre) |
| Impfstoff: „Encepur“ | Standardimpfung | Schnellimpfung |
|---|---|---|
| 1. Impfdosis | Tag Null | Tag Null |
| 2. Impfdosis | 14 Tage - 3 Monate später | 7 Tage später |
| 3. Impfdosis | 9-12 Monate später | 21 Tage nach der ersten Dosis |
| 1. Auffrischimpfung | 3 Jahre später | 12-18 Monate später |
| Auffrischimpfungen | Alle 5 Jahre (< 50 Jahre) | Alle 3 Jahre (≥ 50 Jahre) |
Kleidung und Sprays
Am besten ist es, Zeckenstiche zu vermeiden. Zecken können nicht durch Klamotten durch. Deswegen kann passende Kleidung helfen, dass sie gar nicht bis an unsere Haut kommen können. Besonders bei Wanderungen durch Strauchwerk oder hohes Gras, wie beim Beerensammeln, reduziert Kleidung, die viel Haut bedeckt, das Risiko eines Zeckenbefalls. Lange Hosen, ein langärmliges Hemd und festes Schuhwerk sind hilfreich. Zudem sollte man die Hosenbeine in die Socken stecken. Oft wird auch helle Kleidung zur Zeckenabwehr empfohlen. Allerdings ist das umstritten: In einer schwedischen Studie fühlten sich von heller Kleidung fast 21 Mal mehr Zecken „angezogen“ als von dunkler.11 Der Vorteil heller Kleidung liegt allerdings darin, dass man die krabbelnden Plagegeister schneller entdeckt und entfernen kann, bevor sie den Weg an die Haut gefunden haben.
Es gibt auch spezielle Sprays gegen Zeckenstiche (z. B. Produkte mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin). Sie können Zecken fernhalten und das Risiko eines Stichs verringern. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte weist aber darauf hin, dass diese Sprays nicht lange halten – sie sollten deshalb nach drei bis vier Stunden nochmals aufgesprüht werden.12 Dazu kann man seine Kleidung mit Sprays gegen Zecken „imprägnieren“. Hierfür wird das Insektizid „Permethrin“ verwendet, das Hausstauballergiker mitunter auf ihre Matratzen aufsprühen. Eine Studie aus Korea hat bestätigt, dass der Wirkstoff die Zecken gut abwehrt, weist aber darauf hin, dass der „Anti-Zecken-Effekt“ der mit Permethrin imprägnierten Kleidungsstücke mit der Zeit verfliegt.13
Angepasste Freizeitplanung
Wie schon erwähnt: Zecken mögen feuchte, schattige Orte wie Wälder, Wiesen und hohes Gras. Wenn man sich beim Wandern vorwiegend auf befestigten Wegen bewegt, sinkt auch das Kontaktrisiko. Außerdem: Auch das Wetter spielt eine Rolle. Bei wärmeren Temperaturen ist die Zeckendichte höher, bei trockener Witterung ist sie geringer. Dementsprechend sollte man Wanderung, Picknick oder Gartenarbeit auf bestimmte Tage legen, die nicht so zecken-gefährlich sind.14
Auch interessant: Tipps, wie man sich beim Outdoor-Sport vor Zecken schützen kann
Zecken suchen und entfernen
Zecken sehen schlecht, sind langsam und wandern deshalb oft eine Weile auf der Haut herum, bevor sie zustechen. Sie mögen vor allem weiche Stellen. Besonders gefährdete Stellen sind deshalb Kniekehlen, Achselhöhlen, Hals, Genitalbereich, Bauchnabel, Ellbogen, Haaransatz und der Bereich hinter den Ohren. Nach jedem Aufenthalt im Freien sollte man die Haut gut nach Zecken absuchen. Falls eine Zecke entdeckt wird, sollte sie schnell mit einer feinen Pinzette oder Zeckenkarte entfernt werden. Die Stiftung Gesundheitswissen empfiehlt eine Pinzette, die nach innen gewinkelt ist. Sind die beiden Enden platt, läuft man Gefahr, die Zecke zu quetschen, wenn man sie anpackt – dann drückt man möglicherweise noch mehr Erreger in die Wunde.15 Die Zecke sollte weit vorn (nicht am vollgesogenen Körper) angepackt und langsam und gerade abgezogen werden.