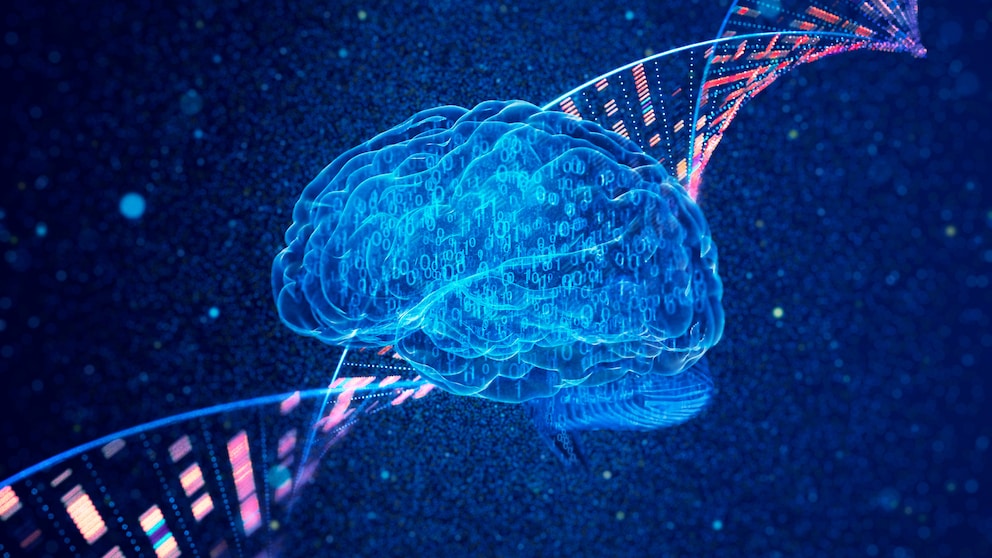30. Mai 2024, 13:26 Uhr | Lesezeit: 5 Minuten
Alzheimer ist eine degenerative Nervenerkrankung, welche mit kognitiven Einbußen einhergeht: Vergesslichkeit und Orientierungsprobleme gehören zum Alltag. Meist tritt die Krankheit bei Menschen über 65 Jahren auf, doch manche erfreuen sich auch im hohen Alter bester geistiger Gesundheit: So identifizierte eine aktuelle Studie aus den Niederlanden seltene Fälle von symptomfreien Alzheimer-Patienten. Wie ist das möglich?
Alzheimer ist die häufigste Form der Demenzerkrankungen. Laut Schätzungen lebten 2021 in Deutschland 1,8 Millionen Betroffene.1 Heilbar ist die Nervenerkrankung bisher nicht, doch eine Studie des Niederländischen Instituts für Neurowissenschaften gibt Hoffnung: Bei ihren Untersuchungen konnten die Wissenschaftler seltene Fälle von Patienten identifizieren, die trotz Alzheimer symptomfrei blieben – Erkenntnisse, die für die Entwicklung von Medikamenten genutzt werden können.
Jetzt dem FITBOOK-Kanal bei Whatsapp folgen!
Übersicht
Wissenschaftler untersuchten Proben von Gehirngewebe
Das Team um Studienleiter Luuk de Vries untersuchte Proben von Gehirngewebe aus der niederländischen Gehirnbank. Diese lagert Gewebe von mehr als 5000 verstorbenen Spendern mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gehirnerkrankungen. Besonders wertvoll macht diese Gehirnbank, dass sie neben dem gelagerten Gewebe mit detailreichen Informationen zur Krankengeschichte der Spender ausgestattet ist. Anhand der Ein- und Ausschlusskriterien der Wissenschaftler eigneten sich 35 Proben für die Untersuchungen. Die Spender wurden wie folgt eingeteilt:
- Gruppe 1: Demente Alzheimer-Patienten mit einem mittleren bis hohen pathologischem Ausmaß
- Gruppe 2: Alzheimer-Patienten mit intakter Kognition und mittlerem bis hohen pathologischen Ausmaß
- Gruppe 3: Altersentsprechende kognitiv intakte Kontrollpersonen mit geringem pathologischem Ausmaß
Proben von Personen, die Anzeichen einer psychiatrischen oder neurologischen Erkrankung aufwiesen, die nicht mit Alzheimer in Zusammenhang standen, wurden von der Studie ausgeschlossen.2
Auch interessant: 5 Ernährungsgewohnheiten, die dem Gehirn schaden können
Es wurde eine resiliente Gruppe identifiziert
Die zweite Gruppe war von besonderem Interesse der Forschenden: Wie konnten diese Personen bis zu ihrem Tod keine kognitiven Auffälligkeiten aufweisen, obwohl ihre Gehirne Alzheimer-typische pathologische Veränderungen zeigten?
In der Hirnbank fand das Team lediglich zwölf Personen, die vor ihrem Tod kognitiv gesund gewesen waren, aber klare neurologische Anzeichen von Alzheimer aufzeigten. Diese Fälle sind also ziemlich selten. Gleichzeitig boten sie den Forschenden die Gelegenheit herauszufinden, was ihre Gehirne so widerstandsfähig machen könnte. Im Fachjargon spricht man hier von „Resilienz“.
Studienautor Luuk de Vries erklärte in einer Meldung des Instituts: „Was bei diesen Menschen auf molekularer und zellulärer Ebene passiert, war bisher nicht klar. Wir glauben, dass Genetik und Lebensstil eine wichtige Rolle bei der Resilienz spielen, aber der genaue Mechanismus ist noch unbekannt.“3
Vier Mechanismen, durch welche Menschen trotz Alzheimer symptomfrei bleiben
Bei der Analyse der Gewebeproben konzentrierten sich die Wissenschaftler auf Unterschiede in der Genexpression. Damit ist gemeint, dass im Körper die DNA abgelesen wird, um anhand der darauf gespeicherten Informationen bestimmte Proteine herzustellen. Ihnen fiel auf, dass in der resilienten Gruppe eine Reihe von Prozessen verändert war. Im Vergleich waren zwischen Gruppe 1 (Alzheimer mit Symptomen) und Gruppe 2 (resilient) sechs Gene signifikant verändert.
Resiliente Gehirne produzieren mehr schützende Antioxidantien und befeuern weniger Entzündungsprozesse
Zwei veränderte Mechanismen betrafen die Astrozytenzellen in den resilienten Gehirnen. Die Astrozyten funktionieren wie eine Müllabfuhr im Hirn und beseitigen Abfallprodukte. Bei den symptomfreien Alzheimer-Patienten wiesen diese Zellen eine höhere Produktion von Metallothionein auf, einem Antioxidans. Weiterhin aktivieren Astrozyten häufig Mikroglia (Immunzellen des Gehirns), welche aufgrund ihrer aggressiven Wirkung jedoch Entzündungen fördern können. In der resilienten Gruppe schien der Mikroglia-Mechanismus, der oft mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht wird, weniger aktiv zu sein.
Toxische Proteine wurden wirksamer entfernt
Die sogenannte „Unfolded Protein Response“ ist eine Reaktion in Gehirnzellen, die automatisch giftige Proteine entfernt, welche mit der Entwicklung von Alzheimer im Zusammenhang stehen. Bei symptomatischen Alzheimer-Patienten war dieser Mechanismus beeinträchtigt, wohingegen er bei resilienten Personen relativ normal war.
Bessere Energieversorgung
Zuletzt fanden die Wissenschaftler Hinweise darauf, dass die Gehirnzellen der resilienten Personen möglicherweise mehr Mitochondrien aufweisen, wodurch eine bessere Energieproduktion möglich ist.

Positive Gehirnveränderungen Wer zwei Sprachen spricht, könnte laut Studie besser vor Alzheimer geschützt sein

Gesundheit Zweimal täglich Zähneputzen kann laut Studie vor Alzheimer schützen

Review der Studienlage Corona könnte laut Forschung ein Risikofaktor für Alzheimer sein
Was bedeuten die Forschungsergebnisse für die zukünftige Behandlung von Alzheimer?
Wenngleich die Entdeckung dieser Unterschiede bedeutsam in der Alzheimerforschung ist, bleibt unklar, wie genau sie mit der Alzheimer-Krankheit zusammenhängen. Der nächste Schritt der Forschung bestehe laut den Autoren darin, herauszufinden, warum es diese Unterschiede in den Produktionsprozessen resilienter Gehirne gibt.
„Es bleibt schwierig, anhand menschlicher Daten zu bestimmen, welcher Prozess den Krankheitsprozess auslöst. Das kann man nur zeigen, indem man etwas in Zellen oder Tiermodellen verändert und dann abwartet, was dann passiert. Das ist das Erste, was wir jetzt tun müssen“, so de Vries.
Wenn die molekularen Grundlagen der Resilienz entschlüsselt sind, bieten sie einen neuen Ansatz für die Entwicklung von Medikamenten, welche bei Alzheimer-Patienten die Resilienz-Prozesse aktivieren könnten.
Studienautoren empfehlen zur Prävention sich weiter selbst herauszufordern
Bis es wirksame Medikamente gibt, helfe es laut de Vries, sich regelmäßig zu fordern: „Bewegung oder kognitive Aktivität sowie viele soziale Kontakte können helfen, den Ausbruch der Alzheimer-Krankheit hinauszuzögern. Kürzlich wurde auch festgestellt, dass Menschen, die viele kognitive Reize erhalten, etwa durch eine anspruchsvolle Arbeit, mehr Alzheimer-Pathologie aufbauen können, bevor Symptome auftreten.“